Durch die momentan angespannte Situation mit reduzierter mangelnder Hebammenversorgung, fehlender Kinderbetreuung, erhöhter Belastung, fehlenden Therapieplätzen etc. besteht leider mehr denn je die Gefahr, dass eine postpartale Depression länger unerkannt bleibt. Umso wichtiger ist es, sie sichtbar zu machen!
Nicht jede Frau*, die ein Baby geboren hat, kann sich uneingeschränkt darüber freuen.
Aber das zu fühlen, das zu sagen oder sich Unterstützung zu holen, ist mit einem großen Tabu verbunden. Denn „es gehört sich nicht.“ Und der Mythos der uneingeschränkten, grandiosen, sich aufopfernden und fähigen Mutterliebe hält sich seit Generationen.
Eine Geburt, gilt immer noch als das Höchste im Leben einer Frau*. Von ihr wird im Anschluss ein einziger Freudentaumel inklusive Dauergrinsen erwartet. Alles andere verstört und darf keinen Raum einnehmen.
Wie passen da schlechte Gefühle, wie das Gefühl, sich nicht angemessen um das Baby kümmern zu können, keine richtigen Mutter*gefühle entwickeln zu können oder gar Aggressionen gegenüber dem Baby zu verspüren…?
Die meisten Betroffenen erfahren und erwarten kaum Verständnis dafür. Häufig nicht einmal von Seiten der Partner*innen.
Dabei ist es wichtig, die PPD als psychische Erkrankung, die wirklich jede*n treffen kann, zu kennen, um sich möglichst schnell Hilfe holen zu können und Bescheid zu wissen. Denn allein diese Wissen kann schon ungemein entlasten.

Was ist eine postpartale Depression und wie häufig tritt sie auf?
Eine postpartale Depression ist eine schwerere, länger andauernde und vor allem behandlungsbedürftige psychische Erkrankung.

Sie kann bei 10 bis 15% Frauen innerhalb des ersten Jahres nach einer Geburt auftreten.
Aufgrund ihres zeitlichen Zusammenhangs mit einer Geburt wird sie als postpartale Depression (PPD) oder auch Wochenbettdepression bezeichnet.
Depressive Symptomatiken nach einer Geburt beginnen häufig schleichend und sind nicht immer leicht abzugrenzen von „normalen Gefühlszuständen“ nach einer Geburt, Zu denen gehören Hormonveränderungen, der sogenannte Baby Blues, der Abschied und die Trauer vom erträumten Kind und der Vorstellung des idealisierten Selbst als Elternteil, die Auseinandersetzung mit dem neuen Körper- und Selbstbild, ganz normale Überforderung und der Übergang in einen neuen Lebensabschnitt.
In erster Linie entsprechen die Symptome einer PPD denen einer depressiven Episode:
Symptome einer Depression
Bei einer depressiven Episode müssen bestimmte Kriterien aus den folgenden drei Feldern erfüllt sein (nach ICD-10):
A. Allgemeine Kriterien:
- Dauer von mindestens zwei Wochen
- Keine zusätzlichen (hypo)manischen Symptome
- Keine Rückschlüsse auf Substanzbmissbrauch oder organische Störungen (dabei stehen ganz besonders Anämien oder Schilddrüsenfunktionsstörungen im Fokus)
B. Mindestens zwei der folgenden drei Symptome:
- ungewöhnlich depressive Stimmung und zwar die meiste Zeit des Tages oder fast jeden Tag und das unbeeinflusst von den Umständen
- Interessens- oder Freudeverlust an Aktivitäten, die normalerweise Freude bereiten
- Verminderter Antrieb oder gesteigerte Ermüdbarkeit
C. Eins + zusätzliche Symptome
- Verlust des Selbstvertrauens oder des Selbstwertgefühls
- Unbegründete Selbstvorwürfe oder ausgeprägte, unangemessene Schuldgefühle
- Wiederkehrende Gedanken an Tod, an Suizid oder suizidales Verhalten
- Vermindertes Denk- oder Konzentrationsvermögen, Unschlüssigkeit oder Unentschlossenheit
- Psychomotorische Agitierheit oder Hemmung
- Schlafstörungen
- Appetitverlust oder gesteigerter Appetit (inkl. Zunahme)
Manchmal mit und manchmal ohne somatisches/körperliches Syndrom (z.B. Schwindel, Kopf-/Magenschmerzen…) und es gibt auch Varianten mit zusätzlich psychotischen Symptomen.
Besonderheiten bei Wochenbettdepressionen
Neben diesen „üblichen“ Symptomen gibt ein paar Besonderheiten:
Zunächst wäre da der zeitliche Zusammenhang mit der Geburt. Im Gegensatz zum “Babyblues“, der bei 25 bis 50 % in den ersten Wochen nach der Geburt auftaucht, – mit leichten depressiven Verstimmungen, Traurigkeit und Stimmungslabilität – und meist spontan innerhalb weniger Stunden oder Tage wieder verschwindet, beginnt eine PPD später, nämlich vier bis sechs Wochen nach der Geburt und sie dauert länger, nämlich mindestens zwei Wochen.
Neben einer wirklich ausgeprägten emotionalen Labilität kommt es auch zu einer Unfähigkeit, positive Gefühle für das Baby zu entwickeln bis hin zu kompletter Gefühllosigkeit, übermäßiger Sorge um das Wohlergehen des Kindes, ausgeprägte Zweifel an den eigenen Fähigkeiten als Mutter und auch zu Versagensängsten. Aber auch Zwangsgedanken und unerklärliche Stillprobleme können Anzeichen sein.
Bei einer postpartalen Psychose (Prävalenz von 0,1 bis 0,2 %) mit Beginn innerhalb der ersten vier Wochen nach der Geburt sind unter anderem Halluzinationen, Gedankeneingebung, zielloses Verhalten und Wahnvorstellungen typisch. Dieser Zustand kann über Wochen und Monate anhalten.
Eine postpartale depressive Episode dauert im Durchschnitt sieben Monate. Statistisch entwickelt etwa die Hälfte der betroffenen Frauen* nach der nächsten Geburt erneut eine Wochenbettdepression.
Risikofaktoren
Es gibt Risikofaktoren, die eine postpartale Depression begünstigen können.
Dazu können depressive Verstimmungen oder andere psychische Erkrankungen in der Vergangenheit gehören, aber auch traumatisch erlebte Geburten, partnerschaftliche Konflikte, mangelnde Unterstützung, traumatische Erlebnisse und Vernachlässigung in der eigenen Kindheit, Stressbelastung in der Schwangerschaft, finanzielle bzw. sozioökonomischen Probleme, biologische Auslöser u.v.m. gehören.
Aber auch Frauen, die in der ersten Woche nach der Geburt eine starke depressive Symptomatik zeigen, bei denen der Baby Blues also extreme Formen annimmt, können daran erkranken.
Was aber auch wichtig ist: Selbst wenn alle Risikofaktoren zutreffen, muss das nicht automatisch eine PPD nach sich ziehen! Und auf der anderen Seite kann wirklich alles wunderbar, bilderbuchmäßig verlaufen und eine Frau* kann dennoch an einer PPD erkranken.
Es kann eigentlich jede*n treffen. Niemand trägt die Verantwortung und muss sich Vorwürfe machen.
Wie kommt es zu einer PPD?
Wie so oft haben wir es mit einer multifaktoriellen Enstehung zu tun: Vermutlich handelt es sich um eine Mischung aus neurochemischen, hormonellen und psychosozialen Faktoren.
Eine Rolle scheint z.B. der postpartale Östrogenabfall als ein möglicher Faktor zu spielen. Aber auch psychosoziale Fragen scheinen ihren Anteil zu haben. Dazu zählen beispielsweise die Rückbildung, die Umstellung auf die neue Aufgaben, Veränderung des Selbst- und Körperbilds aber auch der Übergang aus der Paarbeziehung, insofern es eine gab, in eine neue Beziehungsstruktur.
Übrigens können auch Partner*innen, sogar bis zu 8 %, nach der Geburt Depressionen entwickeln. Das ist aber noch schwieriger zu erkennen. Hierbei spielen dann zwar weniger hormonelle Veränderungen eine Rolle, aber auch für sie handelt es sich um eine gravierende Umstellung und Überforderung. Und auch Geburten können als traumatisch erlebt werden.

Bei Verdacht?
Die Symptome der PPD werden leider oft erst spät oder gar nicht erkannt.
Die Gründe hierfür sind vielschichtig: So verschweigen die betroffenen Frauen* ihre Symptome meist lange aus Scham, Schuldgefühlen oder Angst und auch Partner*innen oder Hebammen verkennen mitunter die Situation.
Zudem taucht die PPD erst nach der Entlassung aus dem Krankenhaus und der engmaschigen Betreuung durch die Hebamme auf. Leider werden meist auch schnell die Gebärenden aus den Augen verloren und das Baby steht im Mittelpunkt, was für die Frauen* und Kinder schwerwiegende Komplikationen nach sich ziehen kann.
Umso wichtiger ist es, Alarmzeichen zu erkennen und sowohl als Gebärende, als Partner*in und als betreuende Person ein Bewusstsein zu haben. Anzeichen sollten gut kommunizieren werden.
Es geht hier nicht um falsche Scham, Unterstellungen oder ähnliches,. sondern um Selbstschutz. Gerade jetzt. Nehmen Sie das bitte ernst!
Es kann mitunter sehr schwer sein, diese Diagnose anzuerkennen und sich um weiterführende Hilfe zu kümmern und leider dauert es, bis Medikamente anschlagen oder passende therapeutische Hilfe gefunden ist.
Wenn Sie den Verdacht haben, selbst erkrankt zu sein, wenden Sie sich bitte sofort an Ihre zuständige Hebamme (auch wenn Sie nicht mehr täglich betreut werden) oder Ihre*n Gynäkolog*in für eine Abklärung. Diese wird Sie im besten Fall weiter verweisen.
Weitere hilfreiche Seiten, Therapeut*innensuchmaschinen und Literaturtipps finden Sie im Anhang an diesen Beitrag.
Testverfahren
Die bekanntesten und am besten geeigneten sind das Strukturierte Klinische Interview für DSM-IV (SKID) und die Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Außerdem sollte eine eingehende körperliche Untersuchung erfolgen, um körperliche Fehlfunktionen auszuschließen (z.B. mögliche Schilddrüsenunterfunktion).
Der Edinburgh-Postnatal-Depression-Scale (EPDS) ist ein Screening-Instrument, das als Selbsteinschätzung Hinweise darauf gibt, ob es sich um eine Erkrankung handeln könnte. Bei Verdachtsfall sollte im Anschluss unbedingt eine weiterführende Diagnostik erfolgen (da es sich auch um eine andere Störung wie z.B. Angststörung handeln kann).

Behandlung
Im Gegensatz zum Baby Blues besteht bei der postpartalen Depression oder bei einer postpartalen Psychose Therapiebedarf.
Denn die Nichtbehandlung einer Wochenbettdepression kann mit Chronifizierung oder Suizid verbunden sein. Und auch beim Baby können Folgen zurückbleiben, wie Bindungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten oder Störungen der emotionalen und kognitiven Entwicklung.
Die Therapie umfasst in der Regel psychotherapeutische Verfahren und medikamentöse Therapie. Manchmal beides, manchmal das eine, manchmal das andere. Das liegt an den betreuenden Ärzt*innen und sollte möglichst in Absprache mit Ihnen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sein.
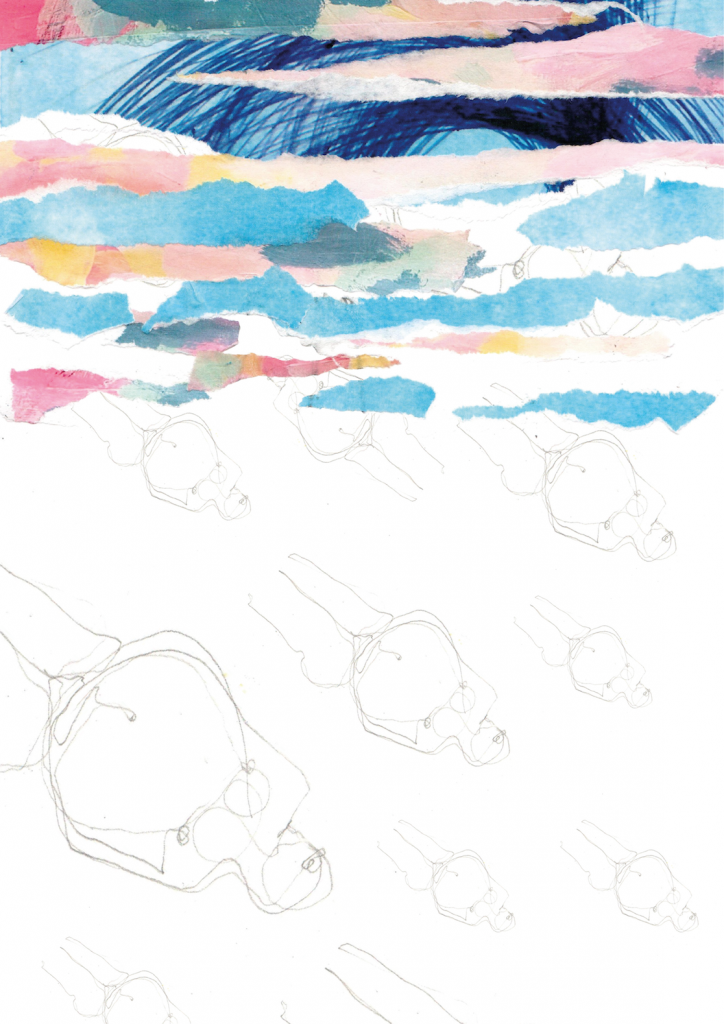
Am häufigsten werden sowohl im Einzel- als auch im Gruppensetting verhaltenstherapeutische, interpersonelle und tiefenpsychologische Psychotherapie eingesetzt.
In der Regel geschieht dies ambulant. Dabei ist aber wichtig und notwendig, dass Sie zuhause Entlastung erfahren! Eine Haushaltshilfe, Freund*innen, ein Einkaufsservice, die (Not)Betreuung in der Kita, Menschen, die Ihnen gut tun, Menschen, die Ihnen zuhören, die Sie verstehen und nicht urteilen… Auch der Austausch mit anderen Betroffenen kann gut tun.
Alles, was Sie unterstützen kann, sollten Sie jetzt wahrnehmen!
Die medikamentöse Therapie erfolgt meist mit trizyklischen Antidepressiva oder selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern. Stillen ist zwar dann nicht grundsätzlich ausgeschlossen, allerdings wird in der Regel eine Nutzen-Abwägung gemacht. Stillen kann für die Eltern-Kind-Bindung wichtig sein und diese steht neben der reinen Behandlung der Wochenbettdepression im Fokus.
Bei leichter oder mittlerer Symptomausprägung wird u.a. deshalb bevorzugt psychotherapeutisch ohne zusätzliche medikamentöse Therapie behandelt. Bei starker Ausprägung der Symptome wird eine Kombination empfohlen.
Sind Suizidgedanken, starke Funktionsbeeinträchtigung oder weitere psychische Erkrankungen vorhanden, führt leider an einer Aufnahme in Psychiatrie kein Weg vorbei.
Für die Suche nach einer geeigneten Therapie ist wichtig, dass Therapeut*innen sich mit Thematik auskennen, denn die Depression fällt in eine besonders sensible Lebensphase, in der die Stärkung Ihrer Beziehung zu Ihrem Kind einen wesentlichen Raum einnehmen sollte.
Leider hat eine depressive Erkrankung meist Einfluss auf das Interaktionsverhalten der Mütter* mit ihrem Baby.
Das bedeutet, dass meist Ihre Fähigkeit, feinfühlig auf das Baby einzugehen, es zu spiegeln und ihm gegenüber positive Gefühle zu zeigen oder engen körperlichen Kontakt gut auszuhalten, eingeschränkt ist. Da Babies nach der Geburt aber noch sehr symbiotisch sind und diese Interaktion brauchen, weil sie ja existenziell abhängig von ihren Eltern sind, können sie darauf unter anderem mit Rückzug, Vermeidung des Blickkontakts, Inaktivität und häufigem Weinen reagieren.
Um Bindungsprobleme oder Beeinträchtigungen der emotionalen und kognitiven Entwicklung zu verhindern, ist es wichtig, mit Ihnen und Ihrem Baby daran zu arbeiten. Es ist wichtig, Ihr Selbstvertrauen als Mutter* zu stärken zugleich die depressive Symptomatik zu verbessern. Denn es ist wichtig, dass Sie sich als Elternteil zunehmend kompetent fühlen und Ihr Baby verstehen lernen. Sie sind Expert*in für Ihr Baby!
Kunsttherapie ist ein psychotherapeutisches Verfahren, das bei leichter und mittlerer Schwere einer PPD und in Kombination mit anderen therapeutischen Verfahren und Behandlungen unterstützen kann. Auch als therapeutische Nachbetreuung, was sich als hilfreich herausgestellt hat, in Form einer Prophylaxe oder für den Notfall oder aber um die erlebte Zeit reflektieren und gut integrieren zu können, kann sie sehr hilfreich sein.
Was bleibt…
Es wird dauern, bis Sie sich wieder gesund fühlen und vermutlich werden Sie im Nachhinein dieser schweren Anfangszeit auch nachtrauern (dürfen!). Aber die Prognosen stehen sehr gut und je schneller Sie sich Unterstützung und passende Hilfe holen, umso schneller kann diese Krise überwunden werden.
Quellen:
Brock, Inés (Hg.): Wie die Geburtserfahrung unser Leben prägt. Perspektiven für Geburtshilfe, Entwicklungspsychologie und die Prävention früher Störungen, Gießen 2018.
Dannhauer, Kareen: Guter Hoffnung. Hebammenwissen für Mama und Baby. Naturheilkunde und ganzheitliche Begleitung, München 2017.
Dilling H., Freyberger, H.J. (Hg.): Taschenführer zur ICD-10-Klassifikation, Bern, 2014.
Rhode, Anke; Dorn, Almut: Gynäkologische Psychosomatik und Gynäkopsychiatrie. Das Lehrbuch, Stuttgart 2007.
Sonnenmoser, Marion: Postpartale Depression: Vom Tief nach der Geburt, Ärzteblatt PP 6, Ausgabe Februar 2007, S. 82.
Stern, Loretta; Gaca, Anja Constanze: Das Wochenbett. Alles über diesen wunderschönen Ausnahmezustand, München 2016.

Literaturtipps, Therapeut*innensuche und hilfreiche Webseiten:
- Schatten und Licht e.V.- Initiative peripartale psychische Erkrankungen mit Selbsthilfegruppen, Fachberater*innen nach Postleitzahlen, Hilfsangebote, Infos: https://schatten-und-licht.de
- Berliner Versorgungsnetzwerk psychosomatische Gynäkologie und Geburtshilfe mit Therapeut*innensuche und Klinikangeboten in Berlin: http://www.frauenpsychosomatik.de
- Krisenbegleitung von Eltern und Familien mit Kindern zwischen 0 und 3 Jahren und bei Krisen nach der Geburt: https://www.schreibabyambulanz.info
- Kassenärztliche Vereinigung, Psychotherapeut*innensuche: https://www.kvberlin.de/fuer-patienten/arzt-und-psychotherapeutensuche
- gewerbliche Seite, Psychotherapeut*innen unabhängig von Kassensitzen: https://www.therapie.de/psyche/info/
- Angebote in Berlin rund um die Geburt: https://geburt-in-berlin.de/vorher-nachher.html
- Dorn, Almut; Rohde, Anke: Krisen in der Schwangerschaft, Stuttgart 2020.
- Rohde, Anke: Postnatale Depressionen und andere psychische Probleme – Ein Ratgeber für betroffene Frauen und Angehörige, Stuttgart 2014.
- Sahib, Tanja: Darauf waren wir nicht vorbereitet – Psychische Krisen rund um die Geburt eines Kindes verstehen und überwinden, Potsdam 2018.
- Schrimpf, Ulrike: Wie kann ich dich halten, wenn ich selbst zerbreche? Meine postpartale Depression und der Weg zurück ins Leben, München 2013.



